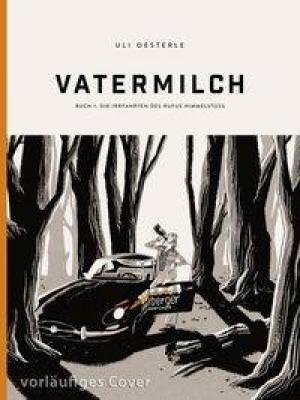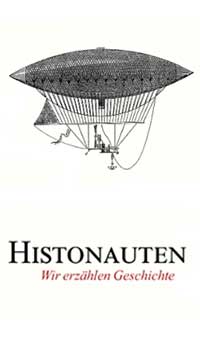Rezensionen
Ohne Obdach, aber mit Champagner
Die neue Graphic Novel »Vatermilch« des Münchner Zeichners Uli Oesterle begibt sich auf die
Suche nach seinem eigenen Vater, der viele Jahre auf der Straße lebte.
Vor dem ältesten Kiosk Münchens schwingt sich Uli Oesterle von seinem Fahrrad. Hier, am Ostufer
der Isar, an der Wittelsbacherbrücke, trinkt der Comickünstler und Illustrator gerne mal ein Bier.
Oder trifft sich mit Freunden. »Der Kiosk liegt auf der Hälfte meiner Radstrecke«, sagt er. Mit
seiner Familie lebt Oesterle in Obergiesing, und mit acht Kollegen teilt er sich ein Atelier in
Schwabing. Der 54-Jährige zeichnet und schreibt nahezu alles: schräge Comics, hochwertige
Graphic Novels, bunte Wimmelbilder, riesige Puzzles und innovative Illustrationen. Seine Bücher
erscheinen in sechs Sprachen.
Die Wittelsbacherbrücke taucht in Oesterles Graphic Novels regelmäßig auf. In seinem neuen Werk
»Vatermilch« ebenso wie im preisgekrönten Band »Hector Umbra« von 2003. »Das Thema
Obdachlosigkeit hat mich schon immer beschäftigt. Und die Wittelsbacherbrücke bietet ja
traditionell vielen Menschen eine Wohnung. Ich mag das hier«, sagt Oesterle, während er zu den
drei Bögen blickt, die das Hochwasserbett und die Isar überbrücken. Der Vater des gelernten
Grafikers war ein schwerer Alkoholiker, der das Geld der Familie in Kneipen und beim Glücksspiel
verschleuderte. Als Oesterle sieben Jahre alt war, machte er sich aus dem Staub. Wie sich
herausstellte, lebte er in einer WG mit zwei anderen Trinkern und immer wieder allein auf der
Straße. 2010 starb er, mittellos, in einem Heim. »Noch immer liegt vieles aus dem Leben meines
Vaters im Dunkeln, und kaum jemand meiner Verwandten wusste damals, was mit ihm los war«,
meint Oesterle. Offenbar litt er unter einer Gedächtnisstörung, dem Korsakow-Syndrom, wie viele
Alkoholkranke.
In seiner neuen Graphic Novel hat der Sohn seinen Vater wieder zum Leben erweckt. Uli Oesterle
erfand die Figur des »Rufus Himmelstoss«, einen charmanten, feschen Hallodri, der sich 1975
durch die Hotspots der Schwabinger Schickeria tanzt. »Ich wollte meinen Vater nicht eins zu eins
abbilden, sondern einen Charakter, der mir gut aus der Feder läuft. Außerdem wollte ich ihm die
Gelegenheit geben, ein besserer Mensch zu sein«, sagt Oesterle. Himmelstoss fährt einen
Sportflitzer, trinkt Champagner, verführt Frauen, verspielt sein Geld, vernachlässigt seine Familie
und stürzt schließlich ab. Als er pleite seinen Schlafsack unter der Wittelsbacherbrücke ausrollt,
schicken ihn die dort lebenden Obdachlosen wieder weg. Der blasierte Lebemann passt nicht zu
ihnen, und er ist nicht bereit sich anzupassen. Am Ende von »Vatermilch« scheint auch Rufus
Himmelstoss am Ende zu sein – doch es gibt offenbar noch viel zu erfahren über diesen
schillernden, tragischen Charakter: Die Erzählung ist auf vier Bände angelegt.
Erst die Geschichte, dann die Illustrationen. Nach diesem Muster arbeitet Oesterle bei all seinen
Projekten. »Das Schreiben ist eine unglaubliche Quälerei. Aber ich kann nicht anders; ich muss
meine Figuren und die Umgebung erst in Worte fassen, damit ich sie im nächsten Schritt sichtbar
machen kann.« Uli Oesterle mag eingerissene und gebrochene Kanten, »es soll rau aussehen, und
das Gebrochene der Charaktere fließt in die Schwarzflächen.« In »Vatermilch« sieht man die 1970er
Jahre des Rufus Himmelstoss in warmem Grau mit Gelb-Orange, wohingegen die Gegenwartsebene
(2005) in einem starken Violett eingefangen wird. In letzterer bewegt sich in der Graphic Novel
auch Victor, der Sohn des Alkoholikers. »Der ist mir schon sehr ähnlich«, gibt Uli Oesterle zu.
Victor ist Illustrator, hadert mit den Genen seines Vaters und sinniert über die Vereinbarkeit von
Familie und Kunst. Wenn er es zu Hause nicht mehr aushält, fl üchtet er ins Atelier, das FBI,
»Federal Bureau of Illustration«. Humor gehört zu Oesterles Geschichten genauso wie die
Abgründe des Lebens, eingefangen in düsteren Farben und schrägen Perspektiven. Und, sehr
typisch für Oesterle, die Musik: »Papa was a rolling stone« ist der Song in »Vatermilch«, und im
legendären Schwabinger »Yellow Submarine« dröhnt »Kung Fu Fighting« aus den Boxen. In
Oesterles Werk »Hector Umbra« wummern dauernd die Bässe – ein DJ ist verschwunden. Sein
Kumpel, ein Maler, sucht ihn und gerät dabei auf einen albtraumartigen Trip durch die Münchner
Kneipen- und Clubszene.
Im Alter von drei Jahren zog der in Karlsruhe geborene Uli Oesterle mit seinen Eltern nach
München. Nun, nicht ganz: eigentlich landete er zunächst in Germering. Der schmucklose Vorort
taucht in »Vatermilch« auf, so wie viele andere reale Plätze Münchens. Oesterles Geschichten sind
tief in der Stadt verankert, die ihn 2018 mit dem Schwabinger Kunstpreis auszeichnete. Übrigens:
Schon mit zehn wollte der Illustrator Zeichentrickfilmzeichner werden, und in gewisser Weise hat
er das ja auch geschafft: Seine Werke wirken bisweilen wie kunstvoll hergestellte Filme. Mit
Figuren, die so was von lebendig sind, sogar im Liegen. Manchmal scheinen sie vom Rand der
Seiten ins reale Leben zu springen, getrieben vom Wunsch, sich selbst zu fi nden. Oder den
obdachlosen Vater.
Diese Rezension hat uns freundlicherweise das "Münchner Feuilleton" zur Verfügung gestellt.